
IP über Werbeumfelder:
9 Thesen zu Bewegtbild
"Flohmarkt" bei Youtube, "Info-Speeddating" mit Facebook, "große Bühnenshow" via TV: RTL-Vermarkter IP weist den Bewegtbildumfeldern in zwei Studien Belohnungsmotive und Werbewirkungen zu.
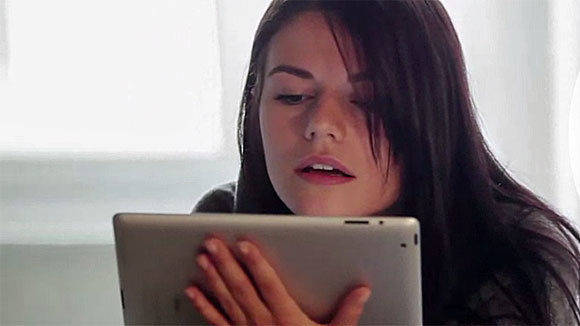
Foto: Screenforce
Bewegtbild ist nicht gleich Bewegtbild - und Kontakt nicht gleich Kontakt. Zu diesem Schluss kommt IP Deutschland, Vermarkter der Mediengruppe RTL Deutschland, in einer der beiden neuen Ausgaben der Gattungsstudie "Kartografie von Bewegtbild".
Bei Einsatz des gleichen Spots auf den verschiedenen Kanälen zeigt sich demnach, dass jeder Videotyp unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen bedient, unterschiedliche Emotionen auslöst und anders auf Marken und auf die Werbewirkung abstrahlt. Für die Analyse wurden sowohl Tiefeninterviews geführt als auch apparative Messungen durchgeführt.
Apropos Emotionen: IP, die Agentur Dentsu Aegis Resolutions und das Medien Institut sind in einer zweiten Studie der Reihe den speziellen Belohnungsmotiven der unterschiedlichen Videokanäle auf den Grund gegangen. Dafür wurden insgesamt über 2000 Personen im Alter von 14 bis 59 Jahren befragt.
Aus den Fragestellungen "Welche Belohnungsmotive haben Menschen, wenn sie Bewegtbild schauen?" und "Wo wirkt Werbung wie?" ergeben sich diese 9 Thesen:
1.
TV kristallisiert sich aus Sicht des TV-Vermarkters als "die große Bühnenshow" für Werbespots heraus. Will heißen: Hier kann der Nutzer passiv die Faszination großer Inhalte genießen, gleichzeitig ist er Teil einer großen Gemeinschaft, die ebenfalls guckt. Werbung ist akzeptiert, verschafft Atempausen und hinterlässt eine hohe Wirkung. Zapping wurde "abgelöst" von Parallelnutzung – meist zu den Inhalten.
2.
Das lineare Fernsehen hat aus Nutzersicht auch das breiteste Belohnungsspektrum, die höchsten Reichweiten und "strukturiert nebenbei den gesamten Tag", wie es heißt. Entspannung stehe im Vordergrund, und das in jeder Lebensphase.
3.
Als Videokanal haben nur noch Onlinevideotheken, wie beispielsweise Netflix und Maxdome, diese breite Motivabdeckung in allen Lebensphasen.
4.
Die Mediatheken stellen laut Studie das TV-Buffet dar. Der Nutzer ist dort aktiv, stellt sich sein Programm selbst zusammen und "verspeist es häppchenweise", wie es heißt. Werbung dort ist vom TV gelernt und wird toleriert, so dass Nutzer hier ähnlich empfinden.
5.
Trotz der starken Nähe zum klassischen TV zeigt sich bei den Mediatheken ein differenzierteres Bild: Hier sind es neben Entspannung vor allem auch Informationen, die Nutzer erwarten und abrufen. Vor allem bei Berufseinsteigern, die ihr Zeitbudget neu strukturieren müssen, stehen die Mediatheken hoch im Kurs und werden vor allem abends und nachts abgerufen.
6.
Anders bei großen Social-Media-Kanälen sieht wie Youtube. Das Netzwerk wird laut IP-Studie als eine Art "Flohmarkt" wahrgenommen – bedingt durch die Vielfalt. Durch diese Fülle sind Nutzer auch ungeduldiger und flüchtiger, unterliegen nahezu einer Reizüberflutung, die zur Dauer-Aktivierung führt. Werbung stoße häufig auf Widerstand und werde mit der Skip-Funktion unterbrochen, wodurch die Wahrnehmungschance geringer sei, heißt es.
7.
Eine sehr junge und spitze Zielgruppe hat Youtube vorzuweisen. Sobald Nutzer aus dem Schulalter heraus sind, wird das Belohnungspotenzial dieses Kanals geringer. In der Lebensphase als Schüler bedient Youtube noch alle Belohnungsmotive, danach stehen nur noch Informationen im Vordergrund - vor allem Tutorials.
8.
Facebook wird im IP-Werk als "Info-Speeddating" bezeichnet – lautlos, diskret, persönlich. Dabei sei Facebook ein kurzfristiges Umfeld mit hoher Aktivierung. Posts werden überflogen, News schnell auf Relevanz gecheckt und Werbung als unpassender Kommerz angesehen. Dennoch gehen Nutzer mit Werbung gelassen um. Sie entscheiden autark, ob sie sich den Spot ansehen oder wegscrollen.
9.
Facebook erreicht zudem nach dem linearen Fernsehen die höchsten Reichweiten, hat dafür aber ein "kleines Belohnungsspektrum". Videos auf Facebook kommen überwiegend zur Anschlusskommunikation zum Einsatz.
In die Studienreihe "Kartografie von Bewegtbild" fließen sechs Jahre Video-Grundlagenforschung, in denen der Kölner Vermarkter verschiedene Videotrends detailliert untersucht hat – angefangen bei der Typisierung der verschiedenen Endgeräte über Second-Screen- und Smart-TV-Nutzung bis hin zu Umfeldwirkung und Belohnungsmotiven verschiedener Video-Plattformen. Mit letzterem beschäftigen sich die neunte und zehnte Ausgabe der Gattungsstudie.



